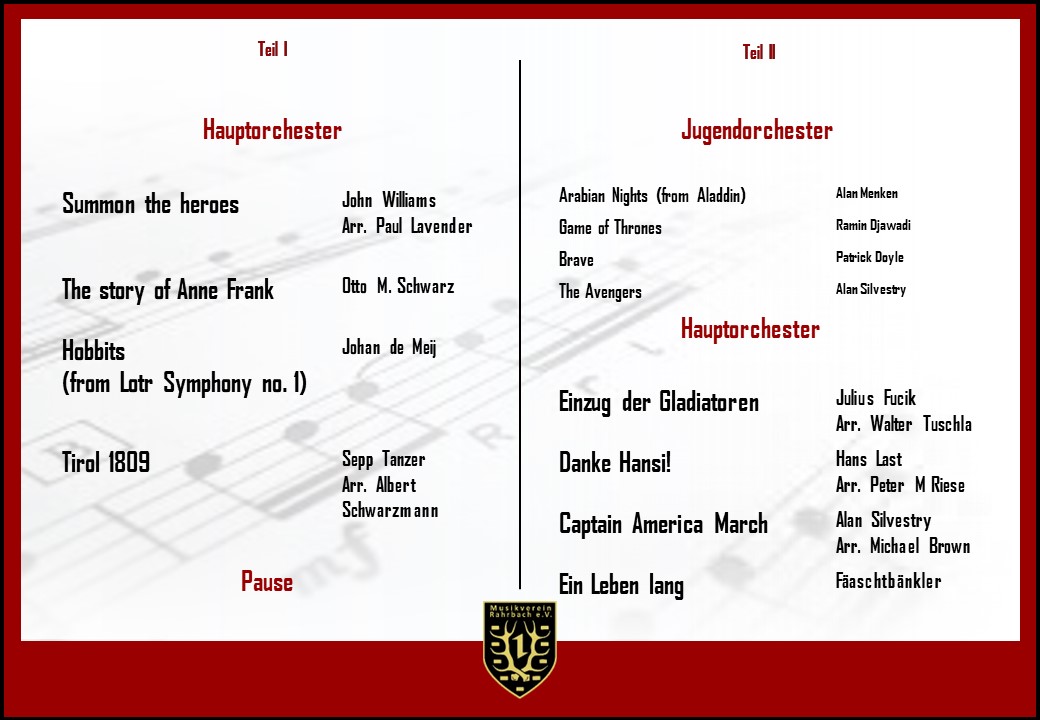Summon the heroes
John Towner Williams, KBE (* 8. Februar 1932 in Flushing, Queens, New York City) ist ein US-amerikanischer Komponist, Dirigent und Produzent von Film- und Orchestermusik. Der mehrfache Oscar- und Grammy-Gewinner zählt seit den 1970er-Jahren zu den weltweit bekanntesten, erfolgreichsten und einflussreichsten Filmkomponisten. Er arbeitete mit Regisseuren wie Steven Spielberg (u. a. Der weiße Hai, Indiana Jones, E.T. – Der Außerirdische, Schindlers Liste, Jurassic Park, Der Soldat James Ryan, A.I. – Künstliche Intelligenz, Minority Report, Catch Me If You Can), George Lucas (Star Wars) und Alfred Hitchcock (Familiengrab) zusammen. Ebenso komponierte er die Musik zu den ersten drei Filmen der Harry-Potter-Reihe. Mit seinem Album The Berlin Concert erreichte er im Alter von 90 Jahren zusammen mit den Berliner Philharmonikern Platz Eins der deutschen Albumcharts.
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Williams_(Komponist)
Anne Frank
Anne Frank, eigentlich Annelies Marie Frank und geboren als Anneliese Marie Frank (* 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main; † Februar oder Anfang März 1945 im KZ Bergen-Belsen), war eine deutsche Jüdin, die 1934 mit ihren Eltern und ihrer Schwester Margot aus Deutschland in die Niederlande auswanderte, um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entgehen, und kurz vor dem Kriegsende dem Holocaust zum Opfer fiel. Von Juli 1942 bis August 1944 lebte sie mit ihrer Familie versteckt in einem Hinterhaus in Amsterdam. Dort hielt sie ihre Erlebnisse und Gedanken in einem Tagebuch fest, das nach dem Krieg als Tagebuch der Anne Frank von ihrem Vater Otto Frank veröffentlicht wurde.
Das Tagebuch gilt als ein historisches Dokument aus der Zeit des Holocausts und die Autorin als Symbolfigur gegen die Unmenschlichkeit des Völkermordes in der Zeit des Nationalsozialismus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank
Otto Martin Schwarz
Otto Martin Schwarz (* 15. Oktober 1967 in Neunkirchen, Niederösterreich) ist ein österreichischer Komponist und Dirigent im Bereich der Filmmusik und sinfonischen Blasmusik.
Otto Martin Schwarz verbrachte seine Kindheit in Wimpassing und erhielt hier seine erste musikalische Ausbildung. Im Jahr 1978 war er Student in der Vorbereitungsklasse von Franz Weiss. Von 1986 bis 1990 studierte er an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Musikpädagogik. Zu seinen Lehrern zählten Josef Pomberger (Trompete) und Heinz Kratochwil (Tonsatz). In den Jahren 1986 bis 1987 war er Mitglied der Militärmusik Burgenland. Ab dem Jahr 1988 unterrichtete Otto Schwarz an der Musikschule Wimpassing und leitet seit 1990 die örtliche Jugendkapelle.
Zu den früheren Kompositionen von Otto Martin Schwarz zählt der Premiere-Marsch für Blasorchester von 1992. Zahlreiche weitere Veröffentlichungen für Blasorchester folgten, darunter Bearbeitungen populärer Werke und Originalkompositionen für sinfonisches Blasorchester. Seit 2001 komponiert er Musik für Fernsehserien und -filme.
Hobbits
Hobbits oder Halblinge sind fiktive, 60 bis 120 cm große menschenähnliche Wesen in der von J. R. R. Tolkien geschaffenen Fantasiewelt Mittelerde. Sie spielen in den Romanen Der Hobbit und Der Herr der Ringe eine tragende Rolle, ebenso in den Verfilmungen Der Hobbit und Der Herr der Ringe von Peter Jackson. In den übrigen Veröffentlichungen Tolkiens werden sie kaum erwähnt.
Hobbits unterscheiden sich von Menschen äußerlich vor allem dadurch, dass sie nur etwa halb so groß sind wie diese (maximal 1,20 Meter), daher auch der Name „Halbling“. Die Proportionen des Körperbaues entsprechen dabei weitgehend denen eines normal ausgewachsenen
Hobbits gelten als friedfertig, haben nie untereinander gekämpft, Kapitalverbrechen sind undenkbar. Ihr Kleidungsstil unterscheidet sich erheblich von der restlichen „Mode“ Mittelerdes, da sie gerne knopfreiche, bunte Westen tragen. Kampfkleidung oder gar Rüstungen sind kaum im Gebrauch.
Trotz ihres ruhigen Lebensstils gelten Hobbits auch als erstaunlich widerstandsfähig und furchtlos, wenn sie dann doch in Bedrängnis geraten, wobei sie vergleichsweise langsam ihren Verletzungen erliegen. Sie zeigen auch eine natürliche Begabung für den Gebrauch von Distanzwaffen, welche Bögen, Schleudern oder einen einfachen Steinwurf per Hand umfassen. Hobbits haben sich nur selten an Kriegen beteiligt; nie versuchten sie Länder zu erobern oder Völker zu unterjochen oder deren Besitztümer zu erlangen.
Johann de Meij
Johannes Abraham Johan de Meij [j’ohɑn dʏ mɛi] (* 23. November 1953 in Voorburg) ist ein niederländischer Dirigent, Posaunist, Arrangeur und Komponist.
Die Sinfonie Nr. 1 The Lord of the Rings (Der Herr der Ringe) nach Motiven aus Tolkiens gleichnamigem Roman war Johan de Meijs erste große Komposition für sinfonisches Blasorchester und wurde 1989 mit dem anerkannten Sudler Composition Award in den USA ausgezeichnet. Im Jahr 2001 spielte das Philharmonische Orchester Rotterdam die Uraufführung der Fassung für Sinfonieorchester. The Lord of the Rings wurde auf mehr als zwanzig CDs von renommierten Orchestern wie dem London Symphony Orchestra und dem Nagoya Philharmonic Orchestra eingespielt. Auch seine anderen groß angelegten Werke wie die Sinfonie Nr. 2 The Big Apple, das T-Bone Concerto (Posaunenkonzert) sowie Casanova (Cellokonzert) fanden ihren Weg in das Repertoire vieler Orchester weltweit. Casanova gewann 1999 den ersten Preis beim Internationalen Kompositionswettbewerb in Corciano (Italien); im Jahr darauf wurde The Red Tower beim Internationalen Kompositionswettbewerb in Oman preisgekrönt. Seine dritte Sinfonie Planet Earth komponierte Johan de Meij im Auftrag des Nordniederländischen Orchesters. Er gewann 2006 mit dieser Sinfonie den zweiten Preis beim Internationalen Kompositionswettbewerb in Corciano. Seine jüngste und fünfte Sinfonie Return to Middle Earth ist bis 2018 im Auftrag des durch die Valparaiso University, Indiana (USA) organisierte The Middle Earth Commissioning Project entstanden.
Außer als Komponist ist Johan de Meij auch als Musiker in verschiedenen Bereichen aktiv. Als Posaunist spielte er mit verschiedenen Niederländischen Ensembles und Orchestern, u. a. das Radio Kamer Orkest, Nederlands Filharmonisch Orkest, Nederlands Blazers Ensemble, The Amsterdam Wind Orchestra und Orkest De Volharding. Darüber hinaus ist er ein gefragter Gastdirigent und Dozent und hat bereits in fast allen europäischen Ländern, in Japan, Singapur, Brasilien, Australien und in den Vereinigten Staaten Konzerte dirigiert und Seminare geleitet. Seit 2010 ist er ständiger Gastdirigent beim Simon Bolivar Youth Wind Orchestra in Venezuela.
Gemälde der berühmten niederländischen Meister Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer und Jan Steen regten Johan de Meij zur dreisätzige „Dutch masters Suite“ für Blasorchester an. Von Meijs Thema und seine Musik wiederum inspirierten die deutsche Zeichnerin, Malerin und Projektkünstlerin Ingrid Sonntag-Ramirez Ponce zum gleichnamigen Kunst-Projekt. Es eröffnete 2014 den Kultursommer Main-Kinzig-Fulda. Der Komponist reiste dazu aus den USA an und dirigierte persönlich den Musikverein 1964 Oberndorf – ein zum Projekt gehörendes, 70-köpfiges symphonisches Blasorchester.
Im September 2019 dirigierte Johan de Meij die deutsche Uraufführung von Return to Middle Earth in Bad Orb und Hanau in einem Konzert der Bläserphilharmonie Rhein-Main unter Mitwirkung des Chors der Freunde der Karl-Rehbein-Schule Hanau, des Chors der TU Darmstadt und dem Projektchor Polyhymnia.
J.R.R. Tolkien
John Ronald Reuel Tolkien [dʒɒn ˈɹɒnld ɹuːl ˈtɒlkiːn], CBE (* 3. Januar 1892 in Bloemfontein, Oranje-Freistaat; † 2. September 1973 in Bournemouth, England), war ein britischer Schriftsteller und Philologe. Sein Roman Der Herr der Ringe (The Lord of the Rings, 1954/55, auf Deutsch erschienen 1969/70) ist eines der erfolgreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts und gilt als grundlegendes Werk für die moderne Fantasy-Literatur.
Tolkien, später Professor für englische Sprachwissenschaft an der Universität Oxford, hatte seit seiner Jugend an einer eigenen Mythologie gearbeitet, die auf eigens konstruierten Sprachen basierte und erst postum unter dem Titel Das Silmarillion erschien. Sowohl Der Herr der Ringe als auch das erfolgreiche Kinderbuch Der Hobbit (1937) spielen in dieser von Tolkien erfundenen Welt. Auch einige seiner sprach- und literaturwissenschaftlichen Beiträge wie der Essay Beowulf: The Monsters and the Critics (1936) gelten als wegweisend.
Tirol 1809
Tirol 1809 ist eine 1952 komponierte Suite für Blasorchester in drei Sätzen von Sepp Tanzer. Das Stück gilt als ein Markstein im Bereich der Original-Blasmusikliteratur. Inhaltlich behandelt das Werk den Tiroler Volksaufstand von 1809.
Vor dem Zweiten Weltkrieg spielten viele Musikkapellen hauptsächlich Märsche aus der Militärtradition oder Bearbeitungen klassischer Werke. So setzte sich Sepp Tanzer neben seinem Lehrer Josef Eduard Ploner[1] besonders für neue Werke im Bereich der Original-Blasmusikliteratur ein. So entstand etwa um das Jahr 1950 die Sinfonie in Es-Dur für Blas-Orchester von Josef Eduard Ploner, die von Sepp Tanzer instrumentiert wurde. Tirol 1809 steht ganz im Zeichen dieser Bestrebungen neuer Originalwerke, komponiert hatte es Tanzer für einen 1952 in Tirol ausgeschriebenen Blasmusik-Kompositionswettbewerb, wofür er den ersten Preis erhielt.
Neben der Sinfonie in Es-Dur gibt es für Tanzer aber auch Vorbilder der klassischen Musik wie etwa die Ouvertüre 1812 von Pjotr Iljitsch Tschaikowski.
Historischer Hintergrund
Die Suite handelt vom Tiroler Volksaufstand, ein Aufstand der Tiroler Bevölkerung gegen die bayrische Besatzung vor dem Hintergrund des Fünften Koalitionskrieges im Jahre 1809. Unter der maßgeblichen Führung Andreas Hofers wurde das Land im Frühjahr 1809 von der bayerisch-französischen Besatzung befreit und bis zum Herbst verteidigt. Erst im November und Dezember 1809 konnten die napoleonischen Truppen das Land erneut besetzen und ihre Herrschaft wieder festigen.
Zeitgeschichtlicher Bezug
Obwohl Tirol 1809 mit den historischen Ereignissen rund um den Tiroler Volksaufstand 1809 und die Person Andreas Hofer ein mehr oder weniger konkretes Programm hat, gibt es einen starken Bezug zur Situation Anfang der 1950er Jahre in Tirol. Sepp Tanzer, der in der NS-Zeit Gaumusikleiter des Gaus Tirol-Vorarlberg war, hatte seine Wurzeln in Südtirol. Die Bestrebungen, Südtirol wieder an Österreich anzugliedern, wurde bereits von Hitler durch das Hitler-Mussolini-Abkommen zunichtegemacht, und ebenso festgefahren stellte sich die Situation nach Ende des Zweiten Weltkrieges dar. So ist der Südtiroler Andreas Hofer nicht nur als historischer Held, sondern auch mit ganz starkem Bezug auf die Einheitsbestrebungen Tirols nach dem Zweiten Weltkrieg zu betrachten.
Des Weiteren sind die zahlreichen anti-französischen Lieder, die verarbeitet werden, neben dem historischen Kontext 1809 auch in der Weise zu betrachten, dass sich Tirol von 1945 bis 1955 unter französischer Besatzung befand.
Aufbau
Das Werk dauert etwa 16 Minuten; mit der barocken Suite hat das Werk eher nichts zu tun, es erinnert vielmehr an eine Battaglia. Das Werk besteht aus drei Sätzen:
1. Aufstand
2. Kampf am Berg Isel
3. Sieg
1. Satz – Aufstand
Der erste Satz verarbeitet vornehmlich das Lied Den Stutzn hear! von Johann Friedrich Primisser (1796),[3] welches jedoch im Gegensatz zum Originallied zunächst in Moll erklingt. Das Lied beginnt im Original mit dem Text: „Den Stutzn hear, beim Saggara, was wölln denn die Franzosn? Hö? moanen sie mit ihrem Gschroa, miar habns Herz in d’Hosen?“, womit gleich zu Beginn klargestellt wird, wer „die Bösen“ sind. Nach der Einleitung in Moll wird das Lied von zwei Piccoloflöten, welche die Schwegelpfeifen der Schützen darstellen, in Begleitung von Marschtrommeln vorgestellt und vom vollen Orchester aufgenommen. Teile des Themas werden daraufhin wieder in Moll in ein Motiv der Hoffnungslosigkeit verarbeitet, welches sich immer mehr steigert und in einem Fortissimo in Moll endet.
2. Satz – Kampf am Berg Isel
Nachdem zu Beginn des zweiten Satzes noch einmal das Motiv des ersten Satzes im unisono von Tenorhörnern und Tuben erklingt geht es direkt in den Choral Wach auf, wach auf, du deutsches Land über. Dieser Choral des deutschen Kantors Johann Walter (1496–1570) wurde in der NS-Zeit seitens der Nationalsozialisten oft für die eigene Position reklamiert.[4][5] Darauf anschließend folgt ein Trompetensignal, das in das Lied Tiroler lasst uns streiten übergeht. Der folgende Verlauf beschreibt die Kampfhandlungen in der Tiroler lasst uns streiten gegen die französische Marseillaise kämpft, ganz ähnlich Tschaikowskis Ouvertüre 1812, bis am Schluss die Marseillaise in Moll erklingt und „verliert“.
3. Satz – Sieg
Im Gegensatz zu den historischen Ereignissen endet die Suite mit dem Sieg. Aus dem verklungenen Schlachtengetümmel klingt eine zarte Melodie im Flügelhorn, welche in ein weiteres anti-französisches Lied, das Spingeser Schlachtlied („Iaz wöll’n mar gien, n’Franzosn z’gög’n gian“[6], 1797) übergeht. Nach einem lyrischen Cantabile, das an eine Alpenweise erinnert, ist ein wuchtiges Bass-Thema zu hören, die Suite endet schließlich mit einem Grandioso.
Einzug der Gladiatoren
Julius Fučík schrieb den Marsch am 17. Oktober 1899 in Sarajevo, wo er seit 1897 als Militärkapellmeister der österreichisch-ungarischen Armee stationiert war.
Ursprünglich nannte er das Stück Grande Marche Chromatique.Der Marsch demonstriert den damals neuesten Stand der Spieltechnik und Bauweise von Blechblasinstrumenten, die in allen Instrumenten und Lagen schnelle und ebenmäßige chromatische Gänge erlaubten. Fučík war aber von der Beschreibung eines Gladiatoren-Auftritts in einem römischen Amphitheater in Henryk Sienkiewicz’ Roman Quo Vadis (1895, dt.: 1896) so beeindruckt, dass er den Titel seines Werkes bald änderte. Die Formulierung „Einzug der Gladiatoren“ ist 1877 in zwei Beschreibungen Pompejis bekannt und wahrscheinlich älter.
Am 10. Januar 1900 erstellt Kapellmeister Anton Fridrich (1849–1924, Khevenhüller-Marsch) in Graz für sich eine Bearbeitung für Streichorchester. Im Juli 1900 ist der bei Hoffmann’s Witwe in Prag erschienene „Concert-Marsch für großes Orchester“ unter dem Titel Einzug der Gladiatoren bei Hofmeister gelistet. Weitere Bearbeitungen folgten. 1903 wird in den Vereinigten Staaten eine von der H.M. Coldstream Guard Band bespielte Tonwalze von Columbia Records mit dem Titel Entry of the Gladiators beworben. Im selben Jahr erschien eine Klavierpartitur mit dem Titel Entry of the Gladiators / Thunder and Blazes (‚Donner und Feuersbrünste‘). Im Englischen ist auch die schon seit mindestens dem 18. Jahrhundert bestehende Formulierung Entrance of the Gladiators üblich.
1901 schrieb der kanadische Komponist Louis-Philippe Laurendeau das Stück um, verwendete ein schnelleres Tempo und eine andere Tonart und veröffentlichte es als Thunder and Blazes. Laurendeau arbeitete oft für Carl Fischer Music in New York. US-Amerikaner sind es gewohnt, den Marsch in einem wesentlich schnelleren Tempo zu hören. Das Stück wurde im nordamerikanischen Zirkus bekannt und zurück nach Europa importiert. Besonders in einer ganz schnellen Fassung ist es die bekannteste Zirkusmusik für Clowns. Es ist auch oft im Repertoire von mechanischen Musikautomaten zu finden.
Spätestens 1904 veröffentlichte Hermann Ludwig Blankenburg seinen Abschied der Gladiatoren. 1928 wurden beide Stücke vom „Großen Odeon-Orchester“ auf einer Platte eingespielt (Nr. 85204).
Julius Fučík studierte in Prag Fagott, Violine und Schlagzeug und nahm nach seinem Musikstudium Kompositionsunterricht bei Antonín Dvořák.
James Last
James Last (* 17. April 1929 in Bremen als Hans Last; † 9. Juni 2015 in West Palm Beach, Florida, Vereinigte Staaten) war ein deutscher Bandleader, Komponist, Arrangeur und Musikproduzent. Er prägte mit seinem 40-köpfigen Orchester den zur Stilrichtung des Easy Listening gehörenden „Happy Sound“, mit dem er ab 1965 rund zwei Jahrzehnte lang einen so großen Erfolg hatte, dass er zeitweise für nahezu 30 Prozent der Schallplattenverkäufe von Polydor Deutschland sorgte.
Captain America
Captain America ist eine US-amerikanische Comicfigur, ein Superheld, der ein Kostüm in den Farben der Flagge der Vereinigten Staaten trägt. Geschaffen wurde sie von Jack Kirby und Joe Simon für den Verlag Timely Publications, einen Vorgänger des heutigen Verlags Marvel Comics. Captain America erschien zuerst 1941 in Heft 1 der Comicserie Captain America Comics. Die zu Kriegszeiten als Propaganda angelegten Comicgeschichten ließen Captain America häufig gegen Nazis, Saboteure und andere Versinnbildlichungen der damaligen Kriegsgegner antreten. In späteren Jahren wurden die Geschichten mit Captain America von vielen Autoren zur Sozialkritik eingesetzt, jedoch gestaltet sich die Rezeption insbesondere in Deutschland schwierig. Im Laufe der Jahre erschienen Figuren mit unterschiedlichen Namen im Kostüm des Captain America. Die ursprüngliche und bekannteste Figur trägt – als Alter Ego – den Namen Steve Rogers.
Captain America: The First Avenger ist eine US-amerikanische Action- und Science-Fiction-Comicverfilmung aus dem Jahr 2011, die auf der Superhelden-Comicfigur Captain America von Marvel Comics basiert. Regie führte Joe Johnston, die Hauptrolle spielte Chris Evans. In den USA und Deutschland war Paramount Pictures für den Verleih zuständig. Der offizielle Filmstart erfolgte in den USA am 22. Juli 2011, in Deutschland am 18. August. Der Film wurde sowohl in 2D als auch in konvertiertem 3D veröffentlicht.
Alan Silvestri
Alan Anthony Silvestri (* 26. März 1950 in Manhattan, New York City) ist ein US-amerikanischer Komponist und Dirigent, der zu den gefragtesten Filmkomponisten in Hollywood zählt. Er machte 1970 seinen Abschluss in Filmmusik an dem renommierten Berklee College of Music in Boston und hat bis dato über 100 Filmmusiken komponiert und dirigiert. Bekannt wurde er vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Robert Zemeckis.
Ein Leben lang – Fäaschtbänkler
Die Musikgruppe wurde 2008 in Kriessern von den fünf Musikkollegen Andreas Frei, Roman Wüthrich, Marco Graber, Michael Hutter und Roman Pizio gegründet. Drei der fünf Bandmitglieder haben Musik studiert (Pizio, Frei, Wüthrich). Die Band wohnt in der Schweiz im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Schweiz.
https://www.faeaschtbaenkler.ch/home.html
Ein Leben lang
An deiner Seite
Bringst mich zum Träumen
Lässt mich niemals allein
Möcht all die Zeit
Dich nie verlieren
Was für ein Glück
Das mich umgibt, ist Musik